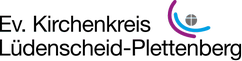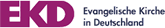Artikel Archiv
Dorf der Diakonie
24.1.2022

RÖNSAHL + Dem Gebäudekomplex „Waldheimat“- heute Teil des Wohnverbunds Volmetal im Bielefelder Evangelischen Johanneswerk – verdankt Rönsahl seinen seit über sieben Jahrzehnten bestehenden Ruf als „Dorf der Diakonie“. Bei der Spurensuche nach den Anfängen dieser Geschichte helfen einige aussagefähige Bilddokumente, mit deren Hilfe schriftliche Überlieferungen aus der Feder des seinerzeitigen Ortsbürgermeisters Artur Voswinkel und des während der Kriegsjahre und danach hier tätigen Hilfspfarrers Albert Turck stammende Aufzeichnungen zusätzliche Transparenz schaffen.
Aus der Dorfchronik geht hervor, dass das um das Jahr 1930 als Fußballplatz des örtlichen Turnvereins genutzte Gelände in der Nazizeit enteignet wurde, um darauf ein so genanntes Arbeitslager zu errichten. Etwa ein Dutzend Baracken beherbergten die zum Reichsarbeitsdienst (RAD) herangezogenen Männer. Im Zweiten Weltkrieg waren sogenannte Arbeitsmaiden, zum RAD herangezogene Frauen, im Lager untergebracht. Gegen Kriegsende erfolgte ein Angriff feindlicher Flieger auf das Lager. Glücklicherweise, so der Bericht, gingen fast alle Bomben in der Umgebung des Lagers nieder, so dass nur eine Tote und wenige Verletzte zu beklagen waren.
Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ 1945 überschlugen sich die Ereignisse auch im kleinen Rönsahl. Die amerikanische Bezirkskommandantur als Besatzungsmacht forderte die Übergabe von zehn Häusern in Rönsahl, damit darin die sogenannten „displayed persons“, vor allem russische Zwangsarbeiter, die auf die Rückkehr in ihre Heimat warteten, untergebracht werden konnten.
Die Evakuierung von insgesamt zehn Häusern durfte auf keinen Fall geschehen. Durch geschicktes Taktieren gelang es, die amerikanische Bezirkskommandantur zu überzeugen, die vorhandenen Baracken für die Arbeit der Inneren Mission zu nutzen und auf diese Weise die Einquartierung von „displayed persons“ zu verhindern.
Unter großzügiger Auslegung der amerikanischen Auflagen war es noch im selben Jahr möglich geworden, das Projekt, alten, pflegebedürftigen Menschen und vor allem auch durch Kriegseinwirkungen verwaisten Kindern eine neue Bleibe zu geben, in die Tat umzusetzen. Das „Evangelische Alters- und Kinderheim“ war aus der Taufe gehoben und damit der Beginn der praktizierten diakonischen Arbeit in Rönsahl, die in den folgenden Jahrzehnten dazu führte, dass der Ort fortan weithin als „Dorf der Diakonie“ bekannt wurde.
Bis Ende 1945, so ein Bericht, lebten 40 alte Männer in einer Baracke mit vier Zimmern. Im Jahr darauf wurde das Heim durch das Evangelische Hilfswerk Westfalen übernommen, und es erfolgte die Aufnahme der ersten Flüchtlingskinder. Damals wurde Diakon Hermann Nöh aus Bethel mit der Leitung der „Anstalt“ betraut. Er war der erste „Hausvater“ im Kinderheim, dem der Name „Wald-Wehme“, was soviel bedeutet wie „Heimat am Walde“, gegeben wurde. Im Dezember 1946 wohnten 140 Menschen im Heim, darunter 60 Kinder aus dem Ruhrgebiet, die zur Erholung da waren.
Auch von vorprogrammierten Schwierigkeiten und Reibungspunkten zwischen der alteingesessenen Dorfbevölkerung und den Heimbewohnern wird berichtet. Teilweise wurde unter der Dorfbevölkerung „viel Ärgernis und Widerstand“ ausgemacht, wie es einmal heißt.

Aber die Arbeit „verantwortungsbewusster Christenmänner“ setzte sich durch. Mit der Zeit gehörte das Kinderheim zum dörflichen Leben. 1951 geht das Heim mit der Gründung des Evangelischen Johanneswerkes in Bielefeld in dessen Trägerschaft über. Allmählich besserten sich die Zeiten. Nach und nach konnten die alten Holzbaracken abgerissen und durch massive Neubauten ersetzt werden. Diese entstanden 1952 und 1956. Dadurch wurde die räumliche Entzerrung des Wohnangebots erreicht. 1956 beispielsweise lebten 91 Kinder im Kinderheim Wald-Wehme.
Im Laufe des folgenden Jahres änderten sich Ansprüche und Konzeptionen, die für das Aufwachsen von Kindern außerhalb ihrer Ursprungsfamilie, also in Heimen, maßgeblich waren, verschiedentlich. So gab es für die Ende 1969 hier lebenden 75 Jungen zu wenig und damit überlastetes Personal, es herrschte Platzmangel, und große Gruppen erschwerten das Zusammenleben, so ein Situationsbericht. Diesbezügliche Überlegungen in der Trägerschaft des Heims führten dazu, eine grundlegende Nutzungsänderung des Gesamtkomplexes durchzuführen und zwar dergestalt, dass das Kinderheim geschlossen und stattdessen an gleicher Stelle ab September 1970 dort Betreuungsarbeit an „männlichen Personen mit geistiger und teils auch körperlicher Behinderung“ geleistet wurde.
Eine „beschützende Werkstatt mit Internat“ löste nahezu übergangslos das bisherige Kinderheim ab. Mit der Zweckänderung vollzog sich auch die Umbenennung des Hauses, das nun den Namen „Waldheimat“ trug. Im Oktober 1970 zogen die neuen Bewohner, Jugendliche über 18 Jahren, ein. „Sie sollen hier Gelegenheit finden, unter kundiger Anleitung ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert zu werden“, hieß es dazu. Diesem Grundprinzip – wenngleich mit wechselnder Ausrichtung – ist der Träger bis auf den heutigen Tag treu geblieben. 1980 konnte das Johanneswerk im ehemaligen Grundschulgebäude in Rönsahl eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen einrichten, die dann bis zum 2014 erfolgten Umzug in den Neubau in Kiersperhagen entsprechend genutzt wurde.
Durch zwischenzeitlich möglich gewordene Einrichtung mehrerer Außenwohngruppen in Kierspe und Meinerzhagen entzerrte sich auch die Wohnsituation in der Waldheimat als solche, verbunden mit dem Ziel, die Zahl der hier noch verbliebenen zumeist älteren Bewohner vor Ort zu verringern – mit allen sich daraus möglicherweise ergebenden strukturellen Veränderungen. Zurzeit, so heißt es dazu, wohnen in der Waldheimat, nicht darin einbezogen sind die Außenwohngruppen, rund vierzig Personen mit besonderem Hilfsbedarf. Zusätzlich bietet der Träger dort bereits seit einigen Jahren ein so genanntes Kurzzeitwohnen an, um pflegende Angehörige zumindest zeitweise zu entlasten. Auch dadurch wird die Einrichtung ihrer Aufgabe als Zentrum der Diakonie in Dorf und Stadt gerecht. ©cr