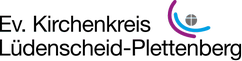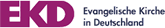Artikel Archiv
Streit um die Kirchenbänke
31.1.2022

RÖNSAHL + Es ist immer wieder spannend, im dicken Buch der Rönsahler Orts- und Kirchengeschichte zu blättern. Dabei tritt dann so manches zutage, das aus dem Leben der Menschen berichtet, die vor hundert oder zweihundert Jahren und zum Teil auch noch länger zurückliegender Zeit im hiesigen Raum lebten.
Dabei wird deutlich, dass es schon vor Zeiten aus Rönsahl einiges zu berichten gab. Nicht zuletzt, weil das Dorf an der Westfalengrenze schon früh mit einer eigenen Gerichtsbarkeit ausgestattet war und am Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen und „an der äußersten südwestlichen Grenze“ Westfalens zur benachbarten Rheinprovinz lag.
So verdanken wir beispielsweise den seit Mitte des 16. Jahrhunderts nahezu lückenlos vorhandenen Kirchenbüchern so manches Wissenswerte und auch Amüsante aus Rönsahls alten Tagen. Im Gegensatz zur damaligen Zeit, als die Sitzplätze in der Servatiuskirche fest vergeben und alteingesessenen Familien und honorigen Bürgern zugeordnet und vererbbar waren und frei verfügbare Plätze während des Gottesdienstes deshalb kaum zur Verfügung standen, hat sich die Situation in unseren Tagen doch sehr verändert. So lässt der Besuch der Gottesdienste in vielen Gemeinden, so des Öfteren auch in der Servatiuskirche, im Allgemeinen zu wünschen übrig – dies derzeit vielleicht auch bedingt durch die andauernde Corona-Situation. Wie anders das doch vordem einmal war, wird durch „betagter Leute Relation“ (Berichterstattung), wie es früher hieß, belegt. So wird in einem alten Gerichtsprotokoll der Gemeinde unter anderem Folgendes festgehalten:
„1680. Carl Eichhorn auf dem Loe verklangt die Engel [Angela] zum Stade, weil dieselbe in seiner Loer Kirchenbank mit dem Gesinde eingehe, und wenn seine Frau und Tochter kommen, denselben nicht weichen wolle, obschon die Benutzung der Bank nur als Vergünstigung anzusehen ist, da er der Beklagten das Recht zur Benutzung der Bank nur deswegen eingeräumt habe, weil es „nahe bey dem Predigtstuhle“ wäre. - Die Bank ist in vorigen Kriegszeiten von den Kriegern verbrennet worden. Der Beklagten wird anbefohlen, den Kirchenstand zu verlassen und das bredt [Brett], welches ihre Vorsassen zum Sitz dieser Kirchenbank verlehnet, anderwärts in der Kirchen, jedoch ohnhinderlich anderer, anzubringen.“
1681 heißt es: „Trine Hollewege ist wegen unsittlichen Lebenswandels bestraft worden und kann die Strafe nicht bezahlen. Diese verpflichtet sich, der Obrigkeit nicht zu entwichen, sondern sich allemal gehorsamst einzustellen und zu erscheinen.“ - Diese Trine Hollewege scheint auch sonst „nicht ohne“ gewesen zu sein, denn 1692 heißt es: „Liese und Trine Hollewege müssen sich dafür verantworten, dass sie am Sonntag gegen öffenttlich „proclama“ gefrevelt, nicht in die ihr angewiesene (Kirchen)-Bank sondern in eine anderen Leuten angewiesene Bank gegangen und die darin eingewiesenen Leute daraus vertrieben. Dieselben behaupten zwar ihr altes Platzrecht, ohnangesehen es ihnen anders befohlen wurde. Da die fünf Goldgulden Brüchte [Strafe] nicht geleistet wurden, mussten die Beklagten „mit der Eysen“ bestrafet werden“.
Im Besitz der Evangelischen Kirchengemeinde ist heute noch ein Relikt aus früheren Jahrhunderten in Form des noch vorhandenen Teils einer Kirchenbank aus damaliger Zeit, das einen „Klas zu Kleinen Fastenrath“ als berechtigten Nutzer ausweist. Dieses Nutzungsrecht galt übrigens auch für die Begräbnisstätten auf dem Kirchhof (Friedhof).
Besagter Klas zu Kleinen Fastenrath wohnte in Kleinfastenrath, einem Gehöft, das schon damals kommunalpolitisch zur rheinischen Nachbargemeinde Klüppelberg (heute Stadt Wipperfürth) zählte, dessen evangelischer Bevölkerungsanteil sich aber von jeher zur Kirche in Rönsahl und zum Teil auch in Halver hielt, weil die protestantische Minderheit im Einzugsbereich der streng katholischen rheinischen Nachbarstadt noch lange nach Einführung der Reformation an freier Glaubensausübung gehindert wurde. In jenen Jahren machte der rheinische Anteil nahezu zwei Drittel der Rönsahler Kirchgänger aus. Das änderte sich erst, als es nach dem großen Dorfbrand im Jahre 1766 und dem danach notwendigen Wiederaufbau des Kirchenschiffes, zu dem die bergischen Gläubigen beitragen sollten, zu Streitigkeiten und in deren Folge in späteren Jahren zur Gründung einer eigenen Gemeinde und zum Kirchenbau in Klaswipper kam. ©cr