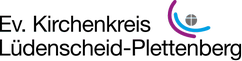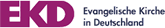Artikel Archiv
Jeder Flüchtling hat seine Geschichte
6.12.2016

Von Guido Raith
Eigentlich sollte es in diesem Artikel um eine neue Abteilung des Fachbereichs Migration im Diakonischen Werk des Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg gehen. Um die Entstehungsgeschichte, die personelle Ausstattung, die aktuelle Situation und natürlich auch um das Warum? des seit einem Jahr bestehenden Psychosozialen Zentrums. Eigentlich. Als Sozialarbeiter Michael Wirth, Leiter der Flüchtlingsberatungsstelle aber nach knapp zwei Stunden Gespräch eine der 350 Akten aus der neben ihm stehenden Hängeregistratur greift und spontan vorliest, kippt die Geschichte.
Simone Lenger im Gespräch mit einem Klienten. (Foto: Raith)
Auch wenn keine Namen genannt werden, bekommt das Flüchtling-Sein nun ein Gesicht. Ein erbärmliches dazu. Michael Wirth liest nur wenige Auszüge aus Erlebnis-Berichten. Wie eine Familie ihre Tochter im Haus versteckt hält, weil ständig Gruppen von Männern alle Mädchen entführen. Sie vergewaltigen. Oder von dem Syrer, der vom Militär flieht, weil er nicht töten will. Der festgehalten wird, den sie an den Füßen aufhängen und immer wieder schlagen. Der unter starken Schmerzen nur mit seinem Militärpass fliehen kann. Und wenn er den in seinem Land zeigt, wird er getötet.
Wirth erzählt von Menschen, die unglaubliche Brutalität in ihrer Heimat erfahren haben. Von Genitalverstümmelung bei Männern in den Balkanstaaten, von Müttern, die vor ihren Kindern vergewaltigt wurden oder von der täglichen Angst, die Zeugen solcher Gräueltaten haben. Angst, von den Peinigern erkannt zu werden. Und das Kino im Kopf geht los. Man stellt sich vor, wie es wäre und was man selbst dann tun würde. Nichts wie weg! Fliehen. Irgendwohin, wo es besser ist.
Jeder Flüchtling hat seine Geschichte. Und wer gerade im Hinterkopf hat, dass seine Familie in Aleppo beschossen wird, der kann nicht einfach so - als wäre nichts - in einen Deutschkurs gehen. Elementar für die Integration sei nicht nur die Bereitschaft dazu, sondern auch die psychische Voraussetzung, erzählt Michael Wirth. Darum gibt es die neue Abteilung, das Psychosoziale Zentrum, in dem er sich, gemeinsam mit den drei Psychologinnen Marie Bette, Simone Lenger und Edith Hansen-Spinger um die Aufarbeitung schwerwiegender Gewalterfahrungen bei Flüchtlingen kümmert. Nach einer Studie der Universität Konstanz rechnet man damit, dass 50 Prozent der geflüchteten Menschen psychosoziale Störungen aufweisen, die ihnen einen Neuanfang erschweren oder ohne Hilfe gar unmöglich machen.

Die Problematik ist nicht neu. Traumatisierte Menschen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, gehörten immer zu den Klienten des Fachbereichs Migration im Diakonischen Werk. Und immer ist hier auch versucht worden, ihnen zu helfen. Aus dem Europäischen Flüchtlingsfond wurden erste Schritte in der Trauma-Arbeit finanziert. Durch Mittel des Landes NRW konnte die Arbeit durch Einrichtung des Psychosozialen Zentrums nun weiter professionalisiert werden. Die vier Mitarbeiter der Abteilung bekleiden jeweils eine halbe Stelle mit 19,5 Stunden pro Woche. Ihrem Terminkalender, der sich bereits nach kurzer Zeit füllte, gesellte sich schnell eine große Warteliste hinzu. Das wundert angesichts der Zahl der Menschen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind, nicht. Rund 10 000 Flüchtlinge leben derzeit im Einzugsbereich des Fachbereichs im Ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg. Der umfasst den südlichen Märkischen Kreis und Teile des Kreises Olpe.

Das Team der Psychologinnen (v.l.): Edith Hansen-Spinger, Simone Lenger und Marie Bette. (Foto: Raith)
Damit den Menschen, die traumatisiert wurden, überhaupt Hilfe zuteil werden kann, bedarf es sensibler Mitarbeiter in den Erstaufnahme-Einrichtungen, die dann mit den Mitarbeitern des Psychosozialen Zentrums in Kontakt treten. Die Symptomatik könne sehr unterschwellig sein, berichtet Michael Wirth. Jemand müsse nicht verhaltensauffällig sein und es sei dennoch möglich, dass er traumatische Störungen habe. Je früher man es erkenne, desto eher wären Integrationsleistungen möglich. Die können dann mitunter Monate oder sogar Jahre in Anspruch nehmen.

Michael Wirth leitet den Fachbereich Migration im Diakonischen Werk. (Foto: Raith)
Die Aufarbeitung der Erlebnisse ist sowohl für die Geflüchteten, als auch für die Diakonie-Mitarbeiter nicht leicht. Simone Lenger: Der Trauma-Bereich bringt noch mal ganz andere Kaliber an Geschichten mit sich. Der Austausch unter Kollegen ist hier sehr wichtig. Die betreuten Menschen seien sehr dankbar. Über zu wenige Klienten können sich die Mitarbeiter des Psychosozialen Zentrums nicht beklagen. In der Region sind wir die einzigen, die diese Arbeit machen, weiß Michael Wirth zu berichten.